Impostor-Syndrom: Warum wir uns manchmal als Hochstapler fühlen
Video-Statistiken
Fühlst du dich manchmal wie ein Hochstapler, obwohl du eigentlich erfolgreich bist? Warum zweifeln so viele Menschen trotz ihrer Leistungen an sich selbst? Wie entsteht dieses zermürbende Gefühl, das als Impostor-Syndrom bekannt ist, und welche Rolle spielen dabei gesellschaftliche Faktoren? Entdecke in diesem faszinierenden Beitrag, wie du deine Selbstzweifel überwinden und deine Erfolge endlich anerkennen kannst.
Kerninhalte
- Das Impostor-Syndrom beschreibt das Gefühl, die eigenen Erfolge nicht verdient zu haben und als Hochstapler entlarvt zu werden
- Betroffene schreiben ihre Leistungen oft dem Glück oder äußeren Umständen zu, nicht den eigenen Fähigkeiten
- Die Clance Impostor Phenomenon Scale (CPS) ist ein wissenschaftliches Instrument zur Messung der Ausprägung des Syndroms
- Das Phänomen wurde 1978 von den Forscherinnen Pauline Clance und Suzanne Imes erstmals beschrieben
- Nicht nur Frauen, sondern auch andere marginalisierte Gruppen sind häufig betroffen
Analyse und Gedanken
- Die “self-worth theory of motivation” erklärt, wie Menschen ihren Selbstwert aus Leistungen ableiten und warum dies problematisch sein kann
- Gesellschaftliche Diskriminierung verstärkt das Impostor-Syndrom bei bestimmten Gruppen durch ständige negative Rückmeldungen
- Das Gefühl, nicht dazuzugehören oder “anders” zu sein, erhöht die Wahrscheinlichkeit, unter dem Impostor-Syndrom zu leiden
- Die Überwindung des Syndroms erfordert sowohl individuelle Arbeit an der eigenen Wahrnehmung als auch gesellschaftliche Veränderungen
- Das regelmäßige Feiern eigener Erfolge ist ein wirksames Mittel gegen Selbstzweifel
Fazit
Das Impostor-Syndrom ist kein persönliches Versagen, sondern ein komplexes Phänomen mit psychologischen und sozialen Wurzeln. Durch Bewusstsein, Selbstreflexion und gezielte Strategien kann jeder lernen, seine Erfolge anzuerkennen und Selbstzweifel zu überwinden.
Das Impostor-Syndrom: Ich kann nichts! (00:00)
Das Impostor-Syndrom beschreibt ein weit verbreitetes psychologisches Phänomen, bei dem Menschen trotz offensichtlicher Erfolge und Leistungen an ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln. Betroffene fühlen sich wie Hochstapler und leben in ständiger Angst, als inkompetent “entlarvt” zu werden. Dieses zermürbende Gefühl führt dazu, dass Erfolge nicht auf die eigenen Fähigkeiten, sondern auf Glück, Zufall oder andere externe Faktoren zurückgeführt werden. Besonders belastend ist die Diskrepanz zwischen der Außenwahrnehmung als erfolgreiche Person und dem inneren Gefühl der Unzulänglichkeit, was zu einem anhaltenden emotionalen Stress führen kann.
Ursachen der Selbstzweifel (00:49)
Die Wurzeln des Impostor-Syndroms liegen oft in der frühen Kindheit und Erziehung, wo bestimmte Erfahrungen das Selbstwertgefühl nachhaltig prägen können. Überhöhte elterliche Erwartungen oder inkonsistentes Feedback können dazu führen, dass Kinder ein instabiles Selbstbild entwickeln. Perfektionismus spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, da Betroffene unrealistisch hohe Standards für sich selbst setzen und jede Abweichung als persönliches Versagen interpretieren. Hinzu kommen neue Herausforderungen oder Umgebungen, die Unsicherheiten verstärken können – etwa der Einstieg in einen neuen Job oder das Studium an einer prestigeträchtigen Universität.
Wie viele Menschen haben das Impostor-Syndrom? (02:06)
Die Verbreitung des Impostor-Syndroms variiert je nach Studie und untersuchter Gruppe erheblich. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass zwischen 25% und 82% der Menschen zumindest zeitweise unter Impostor-Gefühlen leiden, wobei die höheren Zahlen vor allem in leistungsorientierten Umgebungen wie Universitäten oder Technologieunternehmen auftreten. Interessanterweise ist das Phänomen über alle Altersgruppen, Geschlechter und Berufsfelder hinweg zu beobachten, tritt jedoch häufiger bei Menschen auf, die sich in neuen oder herausfordernden Situationen befinden. Die große Bandbreite der Zahlen verdeutlicht auch die Schwierigkeit, das Syndrom einheitlich zu erfassen und zu messen.
Impostor-Selbsttest: die Clance Impostor Phenomenon Scale (02:41)
Die Clance Impostor Phenomenon Scale (CPS) ist eines der am häufigsten verwendeten wissenschaftlichen Instrumente zur Messung des Impostor-Syndroms. Der Fragebogen umfasst 20 Aussagen, die typische Gedanken und Gefühle von Betroffenen widerspiegeln, wie etwa “Ich habe Angst, dass wichtige Personen in meinem Umfeld herausfinden könnten, dass ich nicht so fähig bin, wie sie denken”. Die Bewertung erfolgt auf einer Skala von 1 bis 5, wobei höhere Gesamtwerte auf eine stärkere Ausprägung des Syndroms hindeuten. Die Testergebnisse werden in verschiedene Kategorien eingeteilt: Werte unter 40 Punkten deuten auf milde Impostor-Gefühle hin, während Werte über 80 auf eine starke Ausprägung hinweisen.
Wie zwei Forscherinnen das Impostor-Syndrom entdeckten (04:23)
Das Impostor-Syndrom wurde erstmals 1978 von den Psychologinnen Pauline Clance und Suzanne Imes wissenschaftlich beschrieben. In ihrer bahnbrechenden Studie untersuchten sie hocherfolgreiche Frauen, die trotz objektiver Beweise für ihre Kompetenz unter starken Selbstzweifeln litten. Ursprünglich vermuteten die Forscherinnen, dass hauptsächlich Frauen von diesem Phänomen betroffen seien, was auf gesellschaftliche Geschlechterrollen zurückzuführen sei. Spätere Forschungen zeigten jedoch, dass das Syndrom unabhängig vom Geschlecht auftritt, wobei marginalisierte Gruppen besonders häufig betroffen sind. Diese Entdeckung revolutionierte das Verständnis von Selbstzweifeln und legte den Grundstein für zahlreiche weitere Studien zu diesem Thema.
Selbstwertgefühl und die „self-worth theory of motivation” (05:47)
Die “self-worth theory of motivation” bietet einen wichtigen Erklärungsansatz für das Impostor-Syndrom, indem sie aufzeigt, wie Menschen ihren Selbstwert aus ihren Leistungen ableiten. Nach dieser Theorie definieren sich viele Menschen primär über ihre Erfolge und Fähigkeiten, was zu einem fragilen Selbstwertgefühl führen kann. Wenn der eigene Wert ausschließlich an Leistungen gekoppelt ist, entsteht ein enormer Druck, ständig erfolgreich sein zu müssen. Diese Verknüpfung erklärt, warum Betroffene des Impostor-Syndroms ihre Erfolge oft abwerten oder externalisieren – sie schützen sich unbewusst vor der Angst, bei einem Misserfolg ihren gesamten Selbstwert zu verlieren.
Gesellschaftliche Ursachen (07:00)
Gesellschaftliche Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung des Impostor-Syndroms. Diskriminierung und Stereotypisierung führen dazu, dass bestimmte Gruppen – etwa Frauen in technischen Berufen oder Menschen mit Migrationshintergrund – häufiger an ihren Fähigkeiten zweifeln. Die wiederholte Erfahrung, dass die eigene Kompetenz in Frage gestellt wird, verstärkt das Gefühl, nicht wirklich dazuzugehören. Zudem können kulturelle Normen wie übertriebene Bescheidenheit oder die Stigmatisierung von Selbstlob dazu beitragen, dass Menschen ihre Erfolge nicht angemessen würdigen können. Diese strukturellen Faktoren verdeutlichen, dass das Impostor-Syndrom nicht nur ein individuelles, sondern auch ein gesellschaftliches Problem darstellt.
Hochstapler-Gefühle überwinden: So geht’s (08:04)
Die Überwindung des Impostor-Syndroms beginnt mit dem Bewusstsein für die eigenen Denkmuster und deren Ursprünge. Ein wichtiger Schritt ist das Führen eines Erfolgstagbuchs, in dem auch kleine Leistungen und positive Rückmeldungen festgehalten werden, um ein realistischeres Selbstbild zu entwickeln. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann ebenfalls helfen, da die Erkenntnis, nicht allein mit diesen Gefühlen zu sein, bereits entlastend wirkt. Besonders wirksam ist die bewusste Umdeutung von Selbstzweifeln als Zeichen für Wachstum und Lernbereitschaft statt als Beweis für Inkompetenz. In schweren Fällen kann eine professionelle psychotherapeutische Unterstützung sinnvoll sein, um tiefer liegende Ursachen zu bearbeiten und nachhaltige Veränderungen zu erreichen.
„Ich kann nichts!“ – dieses Gefühl kennen sehr viele. Auch Ralph Caspers hat manchmal Selbstzweifel. Die Angst, nicht gut genug zu sein oder irgendwann aufzufliegen, nennt man Impostor-Syndrom. Warum dieses Gefühl oft auch gesellschaftliche Ursachen hat, erfahrt ihr hier bei Quarks Dimension Ralph.
Von Impostor-Syndrom – oder auch Hochstapler-Syndrom – spricht man, wenn ein kompetenter und erfolgreicher Mensch regelmäßig an sich selbst zweifelt, weil er glaubt, dass sein Erfolg nicht wirklich verdient ist. Und weil er befürchtet, als Betrüger entlarvt zu werden. Erfolge werden dann oft dem Glück oder Zufall zugeschrieben, Misserfolge jedoch der eigenen Unfähigkeit. Menschen mit Impostor-Syndrom haben also Schwierigkeiten, die eigene Leistung richtig einzuschätzen.
Die beiden Wissenschaftlerinnen Pauline Rose Clance und Suzanne Imes von der @georgiastateuniversity haben den Begriff Impostor-Syndrom geprägt. Vor allem Frauen berichteten von diesen Selbstzweifeln. Gemeinsam entwickelten Clance und Imes den Diagnose-Fragebogens CLIPS (Clance Impostor Phenomenon Scale). Den Test könnt ihr hier machen 👉 https://paulineroseclance.com/pdf/IPTestandscoring.pdf und im Video erfahrt ihr auch Ralphs Ergebnis!
In späteren Studien fand man heraus, dass nicht nur Frauen, sondern generell Menschen aus marginalisierten Gruppen häufiger vom Impostor-Syndrom betroffen sind als andere. Und das kann gesellschaftliche Ursachen haben. Direkte oder indirekte Andersbehandlung kann nämlich dazu führen, dass Frauen oder zum Beispiel auch PoC wichtige Bausteine fehlen, um ihren Selbstwert zu boosten. Was das mit der „Self-worth theory of motivation“ zu tun hat und welche Maßnahmen helfen können, um das Impostor-Syndrom zu überwinden und die eigenen Erfolge anzuerkennen, erzählt euch Ralph.
*Kapitel*
0:00 Das Impostor-Syndrom: Ich kann nichts!
0:49 Ursachen der Selbstzweifel
2:06 Wie viele Menschen haben das Impostor-Syndrom?
2:41 Impostor-Selbsttest: die Clance Impostor Phenomenon Scale
4:23 Wie zwei Forscherinnen das Impostor-Syndrom entdeckten
5:47 Selbstwertgefühl und die „self-worth theory of motivation“
7:00 Gesellschaftliche Ursachen
8:04 Hochstapler-Gefühle überwinden: So geht’s
Autoren: Dr. Jan Philipp Rudloff, Ralph Caspers
Schnitt und Grafik: Lutz Kaulmann (Studio Paeper)
Sounddesign: Florian Ebrecht
Redaktion: Nasibah Sfar
*Linktipps*
Selbsttest zum Impostor-Syndrom anhand der „Clance Impostor Phenomenon Scale“ (englisch)
PDF: https://paulineroseclance.com/pdf/IPTestandscoring.pdf
@Quarks Impostor-Syndrom – Warum kann ich meinen Erfolg nicht genießen?
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/daily-quarks/audio-impostor-syndrom—warum-kann-ich-meinen-erfolg-nicht-geniessen-100.html
*Unsere wichtigsten Quellen*
Prevalence, predictors, and treatment of impostor syndrome: a systematic review;
in: Journal of general internal medicine, 2020
https://link.springer.com/article/10.1007/s11606-019–05364‑1
The phenomenology of the impostor phenomenon;
in: Individual Differences Research, 2010
https://www.researchgate.net/profile/Tricia-Yurak/publication/288381712_The_phenomenology_of_the_impostor_phenomenon/links/571f5dbf08aefa64889a7241/The-phenomenology-of-the-impostor-phenomenon.pdf
Pauline Rose Clance, Suzanne Imes: The imposter phenomenon in high achieving women: Dynamics and therapeutic intervention;
in: Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 1978
PDF: https://bottegadinarrazione.com/wp-content/uploads/2020/11/ip_high_achieving_women.pdf
The impostor phenomenon: Self-perceptions, reflected appraisals, and interpersonal strategies. Journal of Personality, 2001
Abstract: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467–6494.00114
The self-worth theory of achievement motivation: Findings and implications;
in: The Elementary School Journal, 1984
1. Seite: https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/461388
Contextualizing the impostor “syndrome”;
in: Frontiers in Psychology, 2020.
https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.575024/
Impostor syndrome among minority medical students who are underrepresented in medicine;
in: Journal of the National Medical Association, 2023
Auszüge: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0027968423000226
Overcoming Imposter Syndrome and Stereotype Threat: Reconceptualizing the Definition of a Scholar;
in: Taboo: The Journal of Culture and Education, 2019
PDF: https://repository.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1205&context=taboo
Hat dir das Video gefallen? Dann abonniere jetzt unseren Quarks-Kanal mit Ralph Caspers @DimensionRalph auf YouTube!
Und hier findest du – auch von Quarks – unser Studio Q: @Quarks
Unsere Kollegen von den Quarks Science Cops gibt’s hier: @quarkssciencecops
@wdr
#impostor #imposter #impostersyndrome #impostorsyndrome #selbstzweifel





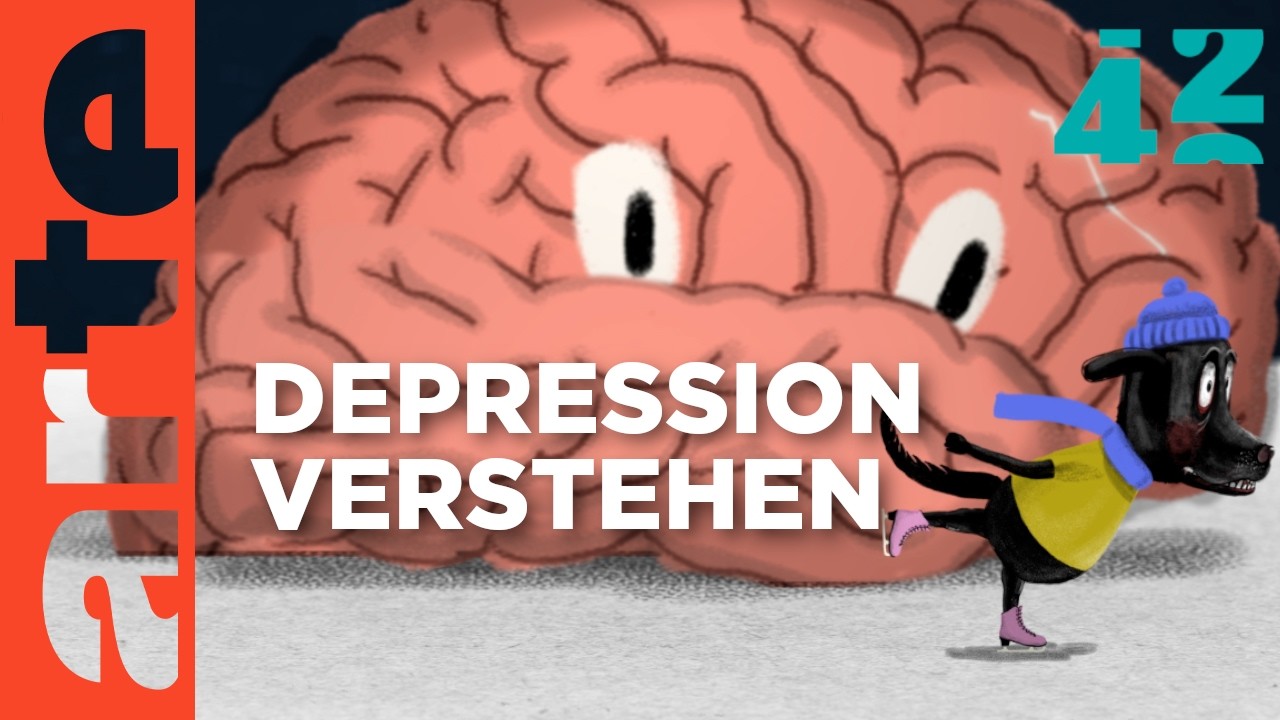








Top 25 Kommentare
Du bist eine Institution und ein großes Vorbild
Fast schon gruselig, dass ich gestern erst über das imposter-syndrome nachgedacht habe, da ich momentan an meinen Fähigkeiten als Mechatronikstudent zweifle. Dabei wahr ich beim Abitur die beste in meinem Jahrgang, hatte in Mathe fast immer 15 Punkte, habe 8 im schriftlichen geschrieben, ohne viel zu lernen und den Abiturpreis in Physik und Englisch gewonnen. Trotzdem komme ich mir momentan ständig zu dumm für mein Studium vor, zweifle an meinen Fähigkeiten und ob ich es überhaupt schaffe. Zum Teil liegt es wohl daran, dass ich bis vor kurzem nicht wusste, dass ich ADHS habe, zum anderen würde ich unterschreiben, dass imposter-syndrome oft Frauen, vor allem in männerdominierten Branchen, betrifft.
Mir wurde oft eingeredet, dass Mädchen besser in Sprachen sind und Jungs in Wissenschaften und Mathe. Mehr als 10 Jahre später, prägt mich das, denke ich, immer noch. “Ich kann ja gar nicht gut in Mathe und Physik sein, ich bin ja eine Frau”. Erfahrungen, bei denen man genau deswegen nicht ernst genommen wird, bestätigen dann leider dieses Weltbild und es wird zum selbstläufer.
Was mir aber gerade hilft, ist Philosophie. Ich lese gerade “Epictetus — discourses and selected writings” und es ist ein verdammt schlaues Buch. Man hat nur Einfluss, auf die Dinge, die innerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Ob man Anerkennung für seine Leistungen bekommt, liegt nicht innerhalb der eigenen Kontrolle und selbst wenn man welche von außen bekommt, wird diese langfristig überhaupt nicht zufriedenstellen. Damit Sie befriedigend ist, muss sie von Innen kommen. Ich habe keinen Einfluss, ob mich andere als Hochstapler entlarven und die Angst davor, wird das nicht verhindern. Worüber ich aber Kontrolle habe, sind meine eignen Gedanken und Taten. Also ist das beste was ich tun kann, auf meine Fähigkeiten zu vertrauen und mein bestes zu geben
Bitte bleib noch lange bei uns und erzähle weiter von den immer wieder faszinierenden Themen!
Vielen Dank für all deine (anscheinend nicht ganz so anstrengende, aber trotzdem harte) Arbeit 🙂
Das gilt natürlich auch für das gesamte Team hinter Quarks Dimension Ralph. Ihr macht auch ganz tolle Arbeit, mit der Recherche, dem Schnitt und allem, was noch so hinter den Kulissen passiert. ❤
mein Vater hat immer gesagt ich lasse sogar Wasser anbrennen und aus mir wird eh nix. etc… 😒 Mit 39 ist mein Selbstwert zwar nicht mehr so sehr angeknackst wie damals, aber ich habe immernoch dran zu knabbern und arbeite daran.
10 Minuten Wissen vermittelt (ich zumindest wusste nicht mal das so etwas gibt und hab was gelernt)
Danke
Mach weiter so! Und Danke!
Titel allein schon sehr relatable xD
Beiträge sind Kult, ein echtes Stück Nostalgie, das einfach nicht verschwinden darf! Ohne dich wäre YouTube nicht dasselbe. Bitte hör nicht auf! ❤❤❤
edit:
9:35 Da bin ich ja mal erleichtert.